 Die Alpenveilchen, auch Zyklamen genannt, haben es gern ein bisschen schattig und gehören als Pflanzengattung in die Unterfamilie der
Die Alpenveilchen, auch Zyklamen genannt, haben es gern ein bisschen schattig und gehören als Pflanzengattung in die Unterfamilie der  Mysteriengewächse. Und da sind wir dann schon ganz nah bei jenem üppigen Stoffmuster, das Hermann Obrist im Jahr 1896 auf einem Wandbehang mit Alpenveilchen in der damals viel beachteten Schaufensterauslage des Kunst-Salon Littauer zeigte: Eine goldfarbene Seidenstickerei prangte auf einer fast zwei Meter hohen Stoffhülle aus Wolle. Prompt wirkte der opulente Kurvenschwung auf die Passanten am Münchner Odeonsplatz wie eine Dynamitladung. Der Entwurf wurde sogleich stilistisch mit einem Peitschenhieb assoziiert. Und, schwups, war aus einem hübschen Ornament das Gründungsmanifest des Jugendstils geworden. Im behäbigen Münchner Gestaltungseinerlei kurz vor der Jahrhundertwende mit seinen vielen Neostilen kam dieses Fanal wie gerufen. Nun ist dies goldene Alpenveilchen, kaum 200 Meter entfernt von da wo alles anfing, nach langer Zeit wieder in einer Ausstellung zu sehen.
Mysteriengewächse. Und da sind wir dann schon ganz nah bei jenem üppigen Stoffmuster, das Hermann Obrist im Jahr 1896 auf einem Wandbehang mit Alpenveilchen in der damals viel beachteten Schaufensterauslage des Kunst-Salon Littauer zeigte: Eine goldfarbene Seidenstickerei prangte auf einer fast zwei Meter hohen Stoffhülle aus Wolle. Prompt wirkte der opulente Kurvenschwung auf die Passanten am Münchner Odeonsplatz wie eine Dynamitladung. Der Entwurf wurde sogleich stilistisch mit einem Peitschenhieb assoziiert. Und, schwups, war aus einem hübschen Ornament das Gründungsmanifest des Jugendstils geworden. Im behäbigen Münchner Gestaltungseinerlei kurz vor der Jahrhundertwende mit seinen vielen Neostilen kam dieses Fanal wie gerufen. Nun ist dies goldene Alpenveilchen, kaum 200 Meter entfernt von da wo alles anfing, nach langer Zeit wieder in einer Ausstellung zu sehen.
 Alpenveilchen sind Primelgewächse und vor allem im Mittelmeerraum, in den Süd- und Ostalpen zuhause. In der Tat war Obrists florale Etüde aber mehr ein abstraktes Symbol als eine realistische Vorlage. Die Stickerin Berthe Ruchet hatte es aus dem Helldunkelkontrast eines zwischen Licht und Schatten changierenden Seidenfadens komponiert. Ungewohnt kraftvoll, überschwänglich, fast übertrieben
Alpenveilchen sind Primelgewächse und vor allem im Mittelmeerraum, in den Süd- und Ostalpen zuhause. In der Tat war Obrists florale Etüde aber mehr ein abstraktes Symbol als eine realistische Vorlage. Die Stickerin Berthe Ruchet hatte es aus dem Helldunkelkontrast eines zwischen Licht und Schatten changierenden Seidenfadens komponiert. Ungewohnt kraftvoll, überschwänglich, fast übertrieben schnörkelig. So setzten sich Obrists gezeichnete oder gestickte Feuerlilien und andere zarten Blumen früh als Inbegriff des Jugendstils durch und in Szene. Sie wurden Zeichen für die Abkehr von Industrialisierung und grauer Vorstadt sowie für die Zuwendung zu einer neuen schwelgerischen Epoche, die dem Historismus in Architektur, Kunst und Kunsthandwerk den Kampf ansagte.
schnörkelig. So setzten sich Obrists gezeichnete oder gestickte Feuerlilien und andere zarten Blumen früh als Inbegriff des Jugendstils durch und in Szene. Sie wurden Zeichen für die Abkehr von Industrialisierung und grauer Vorstadt sowie für die Zuwendung zu einer neuen schwelgerischen Epoche, die dem Historismus in Architektur, Kunst und Kunsthandwerk den Kampf ansagte.
 Aber waren die Münchner Jugendstilkünstler etwa alle Naturburschen? Keineswegs. Es ging mehr um Eskapismus und eine Flucht nach innen. Typische Motive waren schöne Frauen mit wallenden Haaren, atemberaubend attraktive oder grotesk geformte Tiere, Mischwesen. Oder bunt stilisierte Pflanzen, die in Form von Möbeln, Leuchtern oder Kerzenhaltern mit girlandenhaften Extremitäten eine herbeigesehnte Natur spiegelten. Ihre Naturerfahrung
Aber waren die Münchner Jugendstilkünstler etwa alle Naturburschen? Keineswegs. Es ging mehr um Eskapismus und eine Flucht nach innen. Typische Motive waren schöne Frauen mit wallenden Haaren, atemberaubend attraktive oder grotesk geformte Tiere, Mischwesen. Oder bunt stilisierte Pflanzen, die in Form von Möbeln, Leuchtern oder Kerzenhaltern mit girlandenhaften Extremitäten eine herbeigesehnte Natur spiegelten. Ihre Naturerfahrung fanden Maler wie Franz von Stuck, Karikaturisten wie Thomas Theodor Heine, Architekten wie Martin Dülfer und Theodor Fischer eher im Salon als in der Wildnis. Ihre Kunst war ein städtischer Stil – so etwas wie die Urban Art der Jahre um 1900. Auch ihre auf Fassaden in Schwabing, am Harras, auf der Ludwigshöhe, in der Maxvorstadt projizierten Tiere und Lebewesen – Drachen, Lindwürmer, Nixen, Elfen –
fanden Maler wie Franz von Stuck, Karikaturisten wie Thomas Theodor Heine, Architekten wie Martin Dülfer und Theodor Fischer eher im Salon als in der Wildnis. Ihre Kunst war ein städtischer Stil – so etwas wie die Urban Art der Jahre um 1900. Auch ihre auf Fassaden in Schwabing, am Harras, auf der Ludwigshöhe, in der Maxvorstadt projizierten Tiere und Lebewesen – Drachen, Lindwürmer, Nixen, Elfen –  stammten eher aus Fabeln und Sagen als aus dem realen heimischen Wald. August Endells berühmte farbige Wanddekoration, die – bis die Nazis sie 1939 abschlugen – das Fotostudio Hof-Atelier Elvira an der Von-der-Tann-Straße zierte, wurde von Bühnenbildnerinnen jetzt extra für die neue Schau farbig und in Originalgröße
stammten eher aus Fabeln und Sagen als aus dem realen heimischen Wald. August Endells berühmte farbige Wanddekoration, die – bis die Nazis sie 1939 abschlugen – das Fotostudio Hof-Atelier Elvira an der Von-der-Tann-Straße zierte, wurde von Bühnenbildnerinnen jetzt extra für die neue Schau farbig und in Originalgröße nachgebaut. Beispiele für eine reale alpine oder voralpine Kultur gibt es aber auch – etwa das Gemälde einer Bootsfahrerin von Leo Putz oder Plakate nebst Gefäßen, die an die Jugendstilzeit in den Keramischen Werkstätten in Herrsching am Ammersee erinnern.
nachgebaut. Beispiele für eine reale alpine oder voralpine Kultur gibt es aber auch – etwa das Gemälde einer Bootsfahrerin von Leo Putz oder Plakate nebst Gefäßen, die an die Jugendstilzeit in den Keramischen Werkstätten in Herrsching am Ammersee erinnern.
 Wie die meisten der 450 Exponate in der seit gestern offenen Ausstellung Jugendstil. Made in Munich in der Münchner Kunsthalle stammt Hermann Obrists Wandbehang aus dem Besitz des Stadtmuseums, das derzeit wegen Renovierung geschlossen ist. Die von Hängepflanzen zugewucherten Höfe rund um die Kunsthalle München sind deshalb jetzt für das nächste halbe Jahr der Idealort für Einblicke in den Münchner Jugendstil! Die Schau lässt Räume aus längst nicht mehr existenten Jugendstilhäusern der Stadt in einer Art Reenactment mit Originalinventar wiederauferstehen. Und sie organisiert im Nebenprogramm Spaziergänge zu den vielen noch existierenden Bauten aus der Zeit. Von einem mehr wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, bewerten die Aufsätze im Katalog unter anderem den hohen Abstraktionsgrad neu, der im Münchner Jugendstil angelegt war.
Wie die meisten der 450 Exponate in der seit gestern offenen Ausstellung Jugendstil. Made in Munich in der Münchner Kunsthalle stammt Hermann Obrists Wandbehang aus dem Besitz des Stadtmuseums, das derzeit wegen Renovierung geschlossen ist. Die von Hängepflanzen zugewucherten Höfe rund um die Kunsthalle München sind deshalb jetzt für das nächste halbe Jahr der Idealort für Einblicke in den Münchner Jugendstil! Die Schau lässt Räume aus längst nicht mehr existenten Jugendstilhäusern der Stadt in einer Art Reenactment mit Originalinventar wiederauferstehen. Und sie organisiert im Nebenprogramm Spaziergänge zu den vielen noch existierenden Bauten aus der Zeit. Von einem mehr wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, bewerten die Aufsätze im Katalog unter anderem den hohen Abstraktionsgrad neu, der im Münchner Jugendstil angelegt war.
 Der Wille, Neues und Niedagewesenes zu erschaffen, zeigte sich vor allem bei Hermann Obrist, der auch in puncto florale alpine Kultur unser Mann in der neuen Ausstellung ist. Siehe etwa in unserem Foto hier die rätselvolle Gipsskulptur Modell Bewegung von 1914, die schon als Spirale, Wendeltreppe und Muschel apostrophiert worden ist. Obrist, in der Nähe von Zürich geboren, war ursprünglich Naturwissenschaftler und Medizinstudent gewesen, ehe er sich schließlich der Bildhauerei von Grabmälern, Brunnen und Skulpturen sowie Möbeln und allerlei Stoffdesigns zuwandte. Er war zutiefst vom britischen Arts and Crafts Movement beeinflusst. In Florenz gründete er ein Stickereiatelier mit italienischen Kunsthandwerkerinnen, die er dann 1895 mit nach München brachte. Seine
Der Wille, Neues und Niedagewesenes zu erschaffen, zeigte sich vor allem bei Hermann Obrist, der auch in puncto florale alpine Kultur unser Mann in der neuen Ausstellung ist. Siehe etwa in unserem Foto hier die rätselvolle Gipsskulptur Modell Bewegung von 1914, die schon als Spirale, Wendeltreppe und Muschel apostrophiert worden ist. Obrist, in der Nähe von Zürich geboren, war ursprünglich Naturwissenschaftler und Medizinstudent gewesen, ehe er sich schließlich der Bildhauerei von Grabmälern, Brunnen und Skulpturen sowie Möbeln und allerlei Stoffdesigns zuwandte. Er war zutiefst vom britischen Arts and Crafts Movement beeinflusst. In Florenz gründete er ein Stickereiatelier mit italienischen Kunsthandwerkerinnen, die er dann 1895 mit nach München brachte. Seine  Motive gehen mehr als die der anderen Münchner Künstler dieser Jahre von tatsächlicher Natur aus und führen deren Formen schon ins Visionär-Expressionistische weiter: Pilze, Kristalle, mit Dornen und Blüten bewachsene Zacken, eine Felsgrotte mit loderndem Fluss und organisch wucherndes Grün bevölkern auch Obrists Zeichnungen, die zu den stärksten Arbeiten der Münchner Schau gehören. Zu sehen bis ins Frühjahr, mit all den anderen faszinierenden Mysteriengewächsen von Richard Riemerschmid, Bernhard Pankow, Otto Eckmann, Bruno Paul, Peter Behrens, Olaf Gulbransson und vielen anderen.
Motive gehen mehr als die der anderen Münchner Künstler dieser Jahre von tatsächlicher Natur aus und führen deren Formen schon ins Visionär-Expressionistische weiter: Pilze, Kristalle, mit Dornen und Blüten bewachsene Zacken, eine Felsgrotte mit loderndem Fluss und organisch wucherndes Grün bevölkern auch Obrists Zeichnungen, die zu den stärksten Arbeiten der Münchner Schau gehören. Zu sehen bis ins Frühjahr, mit all den anderen faszinierenden Mysteriengewächsen von Richard Riemerschmid, Bernhard Pankow, Otto Eckmann, Bruno Paul, Peter Behrens, Olaf Gulbransson und vielen anderen.
Text und Fotos: © Alexander Hosch
 „Jugendstil. Made in Munich“, Kunsthalle München, bis 23. März 2025.
„Jugendstil. Made in Munich“, Kunsthalle München, bis 23. März 2025.
Mit Objekten aus dem Kunsthandwerk, aus Skulptur, Malerei, Grafik, Fotografie, Mode und Schmuck, www.kunsthalle-muc.de

 Kannte der Maler Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) etwa LSD? Nein, das gab es in den 1930er Jahren noch nicht. Aber womöglich hatte er andere
Kannte der Maler Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) etwa LSD? Nein, das gab es in den 1930er Jahren noch nicht. Aber womöglich hatte er andere  Seelentröster, die das Gemüt entgrenzen, die Formen wuchern lassen und dabei helfen, die Farbwelten zum Explodieren zu bringen. Im Gemälde „Scene aus dem Sommernachtstraum“ von 1937, gerade zu Gast in Bernried am Starnberger See, jedenfalls ergießen sich die Pigmente gleichsam in psychedelischen Strömen. Gesichter werden darin eins mit den Bäumen, oder sie zerfließen in Linien am Firmament. Der in Nazi-Deutschland verfemte ehemalige Die Brücke-Star lebte damals in Davos und hat dort bis
Seelentröster, die das Gemüt entgrenzen, die Formen wuchern lassen und dabei helfen, die Farbwelten zum Explodieren zu bringen. Im Gemälde „Scene aus dem Sommernachtstraum“ von 1937, gerade zu Gast in Bernried am Starnberger See, jedenfalls ergießen sich die Pigmente gleichsam in psychedelischen Strömen. Gesichter werden darin eins mit den Bäumen, oder sie zerfließen in Linien am Firmament. Der in Nazi-Deutschland verfemte ehemalige Die Brücke-Star lebte damals in Davos und hat dort bis  zu seinem Selbstmord nur ein Jahr später genau so eruptiv gemalt: leuchtend, schwelgerisch, ungebeugt. Allein schon der Blick in diese Farbexplosionen ist allemal die kleine Flucht ins Voralpenland wert, wo das faszinierende Kirchner-Gemälde jetzt zusammen mit nicht weniger als 50 weiteren bis Januar bleibt und den reichen eigenen Bestand des Museums der Phantasie mit Buchheims Expressionistenkollektion ergänzt.
zu seinem Selbstmord nur ein Jahr später genau so eruptiv gemalt: leuchtend, schwelgerisch, ungebeugt. Allein schon der Blick in diese Farbexplosionen ist allemal die kleine Flucht ins Voralpenland wert, wo das faszinierende Kirchner-Gemälde jetzt zusammen mit nicht weniger als 50 weiteren bis Januar bleibt und den reichen eigenen Bestand des Museums der Phantasie mit Buchheims Expressionistenkollektion ergänzt. In der Schau geht es in erster Linie um Bilder und ihre Rahmen. Der Münchner Rahmenexperte Werner Murrer hat dieses Verhältnis in langer Geschäftstätigkeit erforscht. Für die Ausstellung „Wiederentdeckt & Wiedervereint“ hat er jetzt mit seinen Co-Kuratorinnen Rajka Knipper und
In der Schau geht es in erster Linie um Bilder und ihre Rahmen. Der Münchner Rahmenexperte Werner Murrer hat dieses Verhältnis in langer Geschäftstätigkeit erforscht. Für die Ausstellung „Wiederentdeckt & Wiedervereint“ hat er jetzt mit seinen Co-Kuratorinnen Rajka Knipper und  Katharina Beisiegel viele solche Gesamtkunstwerke des deutschen Ober-Expressionisten zusammengetragen. Kirchner nämlich hat die schmückenden Holzleisten um seine Gemälde stets selbst bemalt. Ohne Rahmen war ein Bild für diesen Künstler nicht fertig. Oft tauchten die Palettenfarben des jeweiligen Sujets nochmals an den Rändern, in den Spalten und Falzen auf, in feinen Tönen, manchmal auch in breiten Linien. Um sich auf den getreppten, profilierten oder mit Rundstäben verzierten Leisten als Besonderheit ins Spiel zu bringen. Rund 150 Bild-Rahmen-Paare von Kirchner sind insgesamt bekannt, viele tragen die typische Mischung aus Goldbronze mit abgetöntem Grün oder Blau. Eine der in kühlem Violett gehaltenen
Katharina Beisiegel viele solche Gesamtkunstwerke des deutschen Ober-Expressionisten zusammengetragen. Kirchner nämlich hat die schmückenden Holzleisten um seine Gemälde stets selbst bemalt. Ohne Rahmen war ein Bild für diesen Künstler nicht fertig. Oft tauchten die Palettenfarben des jeweiligen Sujets nochmals an den Rändern, in den Spalten und Falzen auf, in feinen Tönen, manchmal auch in breiten Linien. Um sich auf den getreppten, profilierten oder mit Rundstäben verzierten Leisten als Besonderheit ins Spiel zu bringen. Rund 150 Bild-Rahmen-Paare von Kirchner sind insgesamt bekannt, viele tragen die typische Mischung aus Goldbronze mit abgetöntem Grün oder Blau. Eine der in kühlem Violett gehaltenen Wände der Sonderschau haben die Kuratoren allein mit leeren Rahmen aus Kirchners Nachlass geschmückt – denn manchmal fehlen die vor 90 bis 120 Jahren entstandenen zugehörigen Bilder. Es war die Zeit, als von vielen konservativen Bürgern selbst für moderne Sujets lieber „neobarocke Monsterrahmen“ (so Murrer in seiner Begrüßungsrede) gewählt wurden. Und Kirchners individuelle Originalrahmen – heute ein gesuchter Schatz! – mussten in solchen Fällen dann eben weg, weil sie wohl nicht zur Wohnzimmereinrichtung der Besitzer passten.
Wände der Sonderschau haben die Kuratoren allein mit leeren Rahmen aus Kirchners Nachlass geschmückt – denn manchmal fehlen die vor 90 bis 120 Jahren entstandenen zugehörigen Bilder. Es war die Zeit, als von vielen konservativen Bürgern selbst für moderne Sujets lieber „neobarocke Monsterrahmen“ (so Murrer in seiner Begrüßungsrede) gewählt wurden. Und Kirchners individuelle Originalrahmen – heute ein gesuchter Schatz! – mussten in solchen Fällen dann eben weg, weil sie wohl nicht zur Wohnzimmereinrichtung der Besitzer passten. Das Ölbild „Blonde Frau in rotem Kleid“ von 1932 aber (siehe Aufmacherbild sowie zwei Ausschnitte in diesem und im mittleren Absatz) ist herrlich komplett. Es stellt hier eines der schönsten Doppelpacks aus Bild und Rahmen dar. In den schlichten goldbronzierten Nadelholz-Rahmen nahm der Künstler grüne, blaue und rosafarbene „Flecken“ und Striche aus der Farbwahl des Gemäldes mit auf und führte das Motiv auf diese Weise einfach über seineen Bildrand hinaus. Wie bei jedem anderen Auftrag hatte Kirchner die Profile selbst in seinem Skizzenbuch vorgezeichnet, die rohen Leisten in Goldbronze gefasst und diese
Das Ölbild „Blonde Frau in rotem Kleid“ von 1932 aber (siehe Aufmacherbild sowie zwei Ausschnitte in diesem und im mittleren Absatz) ist herrlich komplett. Es stellt hier eines der schönsten Doppelpacks aus Bild und Rahmen dar. In den schlichten goldbronzierten Nadelholz-Rahmen nahm der Künstler grüne, blaue und rosafarbene „Flecken“ und Striche aus der Farbwahl des Gemäldes mit auf und führte das Motiv auf diese Weise einfach über seineen Bildrand hinaus. Wie bei jedem anderen Auftrag hatte Kirchner die Profile selbst in seinem Skizzenbuch vorgezeichnet, die rohen Leisten in Goldbronze gefasst und diese anschließend, in Abstimmung mit dem Gemälde, bemalt. Ein Kunstwerk hörte für Kirchner – spätestens seit er 1918 in die Schweiz emigriert war – definitiv nicht mehr mit dem Bildrand auf. Kirchners spezielle Davoser Rahmen, aber auch simplere Bretter-Rahmen sowie andere Beispiele mit Stufen, Treppen und Eckverbindungen sind an den Wänden dieser überaus sehenswerten Ausstellung natürlich genau erklärt – alpine Reinkultur! Eine tolle Schau, die danach, in veränderter Form, ans Kirchner-Museum in Davos geht.
anschließend, in Abstimmung mit dem Gemälde, bemalt. Ein Kunstwerk hörte für Kirchner – spätestens seit er 1918 in die Schweiz emigriert war – definitiv nicht mehr mit dem Bildrand auf. Kirchners spezielle Davoser Rahmen, aber auch simplere Bretter-Rahmen sowie andere Beispiele mit Stufen, Treppen und Eckverbindungen sind an den Wänden dieser überaus sehenswerten Ausstellung natürlich genau erklärt – alpine Reinkultur! Eine tolle Schau, die danach, in veränderter Form, ans Kirchner-Museum in Davos geht.



 Oder wie die beiden Evidence Paintings, schon 1994 in Grooms großer Soloschau des Münchner Lenbachhauses präsentiert. Rechteckige Flächen in Pechschwarz und gebrochenem Weiß sind zu kompakten Formen zusammengeschlossen, die auf grauem, schneeweißem oder nachtschwarzem Grund schweben und dabei fast eine körperliche Wirkung erlangen. Es geht darum, was zwischen den Farben geschieht.
Oder wie die beiden Evidence Paintings, schon 1994 in Grooms großer Soloschau des Münchner Lenbachhauses präsentiert. Rechteckige Flächen in Pechschwarz und gebrochenem Weiß sind zu kompakten Formen zusammengeschlossen, die auf grauem, schneeweißem oder nachtschwarzem Grund schweben und dabei fast eine körperliche Wirkung erlangen. Es geht darum, was zwischen den Farben geschieht. Bei der Erschließung seiner Bildwelten bietet Jon Groom gerne fernöstliche Weisheiten an. „Meine Gemälde sind leer und zugleich gefüllt“, sagt er. Und: „Abstraktion handelt vom Mysterium, eine Farbe neben die andere zu setzen.“ Das Arkanum lässt sich auch über einen Bezug zur Landschaft entschlüsseln, eine Naturerfahrung, die sich in dieser Gegend auf denkbar reizvollste Weise gestaltet und zahlreiche Künstlerinnen und Künstler angezogen hat.
Bei der Erschließung seiner Bildwelten bietet Jon Groom gerne fernöstliche Weisheiten an. „Meine Gemälde sind leer und zugleich gefüllt“, sagt er. Und: „Abstraktion handelt vom Mysterium, eine Farbe neben die andere zu setzen.“ Das Arkanum lässt sich auch über einen Bezug zur Landschaft entschlüsseln, eine Naturerfahrung, die sich in dieser Gegend auf denkbar reizvollste Weise gestaltet und zahlreiche Künstlerinnen und Künstler angezogen hat. Ein Instant-Konzert in München wäre natürlich der Wahninn gewesen. So aber wurde es immerhin eine wunderbare Überraschungsausstellung für das Haus der
Ein Instant-Konzert in München wäre natürlich der Wahninn gewesen. So aber wurde es immerhin eine wunderbare Überraschungsausstellung für das Haus der 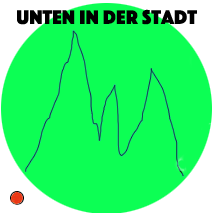 Kunst, die – nur Stunden vorher angekündigt – am Freitag begann. Im Geheimen vorbereitet, war sie von langer Hand geplant. Pussy Riot stellen genau dort nun bis 2. Februar 2025 im ehemaligen Luftschutzbunker des Ausstellungshauses aus (www.hausderkunst.de). Die allesamt feministischen und queeren Musikerinnen, Aktivistinnen und Künstlerinnen berichten in der Schau voller Farbenfreude und mit handgeschriebenen Wandbotschaften über ihren Velvet Terrorism, also den gewaltfreien Widerstand, der sich gegen Putins Homophobie wie auch gegen Russlands Krieg in der Ukraine richtet. Mit Videos aus Moskauer Kirchen und von Moskauer
Kunst, die – nur Stunden vorher angekündigt – am Freitag begann. Im Geheimen vorbereitet, war sie von langer Hand geplant. Pussy Riot stellen genau dort nun bis 2. Februar 2025 im ehemaligen Luftschutzbunker des Ausstellungshauses aus (www.hausderkunst.de). Die allesamt feministischen und queeren Musikerinnen, Aktivistinnen und Künstlerinnen berichten in der Schau voller Farbenfreude und mit handgeschriebenen Wandbotschaften über ihren Velvet Terrorism, also den gewaltfreien Widerstand, der sich gegen Putins Homophobie wie auch gegen Russlands Krieg in der Ukraine richtet. Mit Videos aus Moskauer Kirchen und von Moskauer Dächern, die jetzt zwischen bunten Wänden gezeigt werden. Mit Aktionen, farbigen Masken und Klebestreifen, mit Fotos, mit Installationsgerät und mit Punkmusik protestieren sie. Was immer wieder zu Schlägen und Verletzungen, zu Arresten und Verfolgung der Protagonistinnen führt. Die samtene Rebellion von Pussy Riot gegen Putin, einen der vielen rechten Irren, die zur Zeit die Welt bedrohen, ist für die Mitstreiterinnen seit mehr als einem Jahrzehnt lebensgefährlich – auch wenn die meisten mittlerweile im Ausland leben. Putins Geheimdienstler und Kleptokraten sind aber vermutlich überall. Deshalb war die
Dächern, die jetzt zwischen bunten Wänden gezeigt werden. Mit Aktionen, farbigen Masken und Klebestreifen, mit Fotos, mit Installationsgerät und mit Punkmusik protestieren sie. Was immer wieder zu Schlägen und Verletzungen, zu Arresten und Verfolgung der Protagonistinnen führt. Die samtene Rebellion von Pussy Riot gegen Putin, einen der vielen rechten Irren, die zur Zeit die Welt bedrohen, ist für die Mitstreiterinnen seit mehr als einem Jahrzehnt lebensgefährlich – auch wenn die meisten mittlerweile im Ausland leben. Putins Geheimdienstler und Kleptokraten sind aber vermutlich überall. Deshalb war die  strikte Geheimhaltung der Münchner Termine bis gestern Mittag notwendig. Abends jedoch fand im vollbesetzten Terrassensaal ein Gespräch von Haus-der-Kunst-Chef Andrea Lissoni mit einigen der Akteurinnen des Kunstkollektivs statt. Widerstand gegen einen russischen Polit-Zombie von heute, im Herzen und im Keller eines Fascho-Tempels von früher – das ist eine doppelte Brechung. Die Überraschung ist gelungen, die Ausstellung sehr gut. Unbedingt hingehen!
strikte Geheimhaltung der Münchner Termine bis gestern Mittag notwendig. Abends jedoch fand im vollbesetzten Terrassensaal ein Gespräch von Haus-der-Kunst-Chef Andrea Lissoni mit einigen der Akteurinnen des Kunstkollektivs statt. Widerstand gegen einen russischen Polit-Zombie von heute, im Herzen und im Keller eines Fascho-Tempels von früher – das ist eine doppelte Brechung. Die Überraschung ist gelungen, die Ausstellung sehr gut. Unbedingt hingehen!

 In der Wand sitzt
In der Wand sitzt 


 Auf einer kugelrunden Spezialität aus Marzipan, Nougat, Schokolade und Pistazien sitzt in jeder
Auf einer kugelrunden Spezialität aus Marzipan, Nougat, Schokolade und Pistazien sitzt in jeder  Im klassizistischen Stammsitz der Galerie von Thaddaeus Ropac etwa, der direkt am Mirabellplatz in der rechtsufrigen Altstadt gelegenen Villa Kast residiert, verblüfft der große, mit gelber Ölfarbe bemalte Bronzekopf einer Trümmerfrau aus der Serie „Dresdner Frauen“ (1990/2023). Georg Baselitz ist ihr Schöpfer. Daneben beherrscht der meist am Ammersee arbeitende deutsche Malergigant die auch die anderen ansonsten leeren Räume mit großen blauen Gemälden, die überwiegend Adler abbilden. Bis ihn dann Ende Juli ein anderer deutscher Großkünstler, Anselm Kiefer, ablösen wird. Man muss sich einfach nur trauen, den opulenten Palazzo zu betreten.
Im klassizistischen Stammsitz der Galerie von Thaddaeus Ropac etwa, der direkt am Mirabellplatz in der rechtsufrigen Altstadt gelegenen Villa Kast residiert, verblüfft der große, mit gelber Ölfarbe bemalte Bronzekopf einer Trümmerfrau aus der Serie „Dresdner Frauen“ (1990/2023). Georg Baselitz ist ihr Schöpfer. Daneben beherrscht der meist am Ammersee arbeitende deutsche Malergigant die auch die anderen ansonsten leeren Räume mit großen blauen Gemälden, die überwiegend Adler abbilden. Bis ihn dann Ende Juli ein anderer deutscher Großkünstler, Anselm Kiefer, ablösen wird. Man muss sich einfach nur trauen, den opulenten Palazzo zu betreten. Ein anderes – im Gegensatz zur Baselitz-Skulptur – sogar ständiges Salzburger Kopfkino liefert nebenan der älteste europäische „Zwergerlgarten“ im westlichen Teil des barocken Mirabellgartens. Neben einem bildschönen Einhorn, dem Heckentheater, dem Rosengarten und 100.000 anderen (übers Jahr verteilt blühenden) Blumen ist er mit Abstand die schönste Zierde dort, Besuchende können sie im Sommer täglich von 6 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit kostenlos durchqueren. Die 28 Zwergskulpturen aus Untersberger Marmor wurden 1695 von Erzbischof Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein bestellt und auf der Lodronschen Wasserbastei
Ein anderes – im Gegensatz zur Baselitz-Skulptur – sogar ständiges Salzburger Kopfkino liefert nebenan der älteste europäische „Zwergerlgarten“ im westlichen Teil des barocken Mirabellgartens. Neben einem bildschönen Einhorn, dem Heckentheater, dem Rosengarten und 100.000 anderen (übers Jahr verteilt blühenden) Blumen ist er mit Abstand die schönste Zierde dort, Besuchende können sie im Sommer täglich von 6 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit kostenlos durchqueren. Die 28 Zwergskulpturen aus Untersberger Marmor wurden 1695 von Erzbischof Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein bestellt und auf der Lodronschen Wasserbastei postiert. 1811 wurden jedoch alle Zwerge versteigert. Im Lauf der vergangenen 113 Jahre konnten 19 davon – mühsam und ganz allmählich – wieder zurückgekauft werden. Wie etwa der „Zwerg mit Kastagnetten“ ganz oben. Oder der „Zwerg mit Ball“ auf unserem größten Foto. Von noch abgängigen Zwergen künden leere Podeste. Noch immer fehlen zum Beispiel die einst von einem Künstlerkollektiv geschaffenen „Monatszwerge“ für Februar und November. Aber der „Zwerg mit dem Strohtaschenhut“ (Abbildung links unten) ist gottlob wieder da – als einer von ursprünglich fünf Duellanten wartet er im Halbschatten. So kann der Salzburger Hochsommer ruhig kommen.
postiert. 1811 wurden jedoch alle Zwerge versteigert. Im Lauf der vergangenen 113 Jahre konnten 19 davon – mühsam und ganz allmählich – wieder zurückgekauft werden. Wie etwa der „Zwerg mit Kastagnetten“ ganz oben. Oder der „Zwerg mit Ball“ auf unserem größten Foto. Von noch abgängigen Zwergen künden leere Podeste. Noch immer fehlen zum Beispiel die einst von einem Künstlerkollektiv geschaffenen „Monatszwerge“ für Februar und November. Aber der „Zwerg mit dem Strohtaschenhut“ (Abbildung links unten) ist gottlob wieder da – als einer von ursprünglich fünf Duellanten wartet er im Halbschatten. So kann der Salzburger Hochsommer ruhig kommen. Schnitzel oder Backhendlsalat? Bärenwirt:
Schnitzel oder Backhendlsalat? Bärenwirt: 
 forcieren die immer weitere Ausdehnung der alpinen Siedlungen in die Breite. Das führt jedoch zu noch mehr einzelnen Häusern in der Landschaft. Die andere Fraktion – in der Minderzahl – setzt sich seit mindestens Mitte des 20. Jahrhunderts für die nachhaltige und konsequente Etablierung einer Moderne in Form von Hochhäusern ein. Auch oder gerade in den Hochalpen. Das Ziel: weniger Zersiedelung der kostbaren Natur, weniger Bodenversiegelung. Und in der Konsequenz dann auch weniger Straßenbau. Vorgemacht haben das in Sestriere bei Turin etwa schon um 1940 die Architekten von zwei 16-stöckigen Rundtürmen (einer enthält heute noch das Grand Hotel Ducchi d´Aosta). Beide Türme wurden damals im Auftrag der ehemaligen Besitzer von Fiat, der Familie Agnelli, errichtet. Ebenfalls auf ein alpines Hochhaus setzte – ein gelungenes jüngeres Beispiel – vor rund 15 Jahren am Katschberg der Mailänder Architekt Matteo Thun, als er inmitten des österreichischen Tauerngebirges ein anderes Rundhochhaus für Serviced Apartments baute. Pioniere der Moderne.
forcieren die immer weitere Ausdehnung der alpinen Siedlungen in die Breite. Das führt jedoch zu noch mehr einzelnen Häusern in der Landschaft. Die andere Fraktion – in der Minderzahl – setzt sich seit mindestens Mitte des 20. Jahrhunderts für die nachhaltige und konsequente Etablierung einer Moderne in Form von Hochhäusern ein. Auch oder gerade in den Hochalpen. Das Ziel: weniger Zersiedelung der kostbaren Natur, weniger Bodenversiegelung. Und in der Konsequenz dann auch weniger Straßenbau. Vorgemacht haben das in Sestriere bei Turin etwa schon um 1940 die Architekten von zwei 16-stöckigen Rundtürmen (einer enthält heute noch das Grand Hotel Ducchi d´Aosta). Beide Türme wurden damals im Auftrag der ehemaligen Besitzer von Fiat, der Familie Agnelli, errichtet. Ebenfalls auf ein alpines Hochhaus setzte – ein gelungenes jüngeres Beispiel – vor rund 15 Jahren am Katschberg der Mailänder Architekt Matteo Thun, als er inmitten des österreichischen Tauerngebirges ein anderes Rundhochhaus für Serviced Apartments baute. Pioniere der Moderne.
 entwickelte sich Frankreichs hochalpine Landschaft nach dem Zweiten Weltkrieg progressiver: Die Staatsregierung befürwortete und förderte schon zu Zeiten Charles de Gaulles zusammen mit den Touristikern die Idee eines organisierten Frühjahrsurlaubs der ganzen arbeitenden Bevölkerung in den Bergen sowie eines weitgehend problemlosen „Ski in, Ski out“, ohne tägliches Verkehrsaufkommen. Unterstützt vom französischen Staat bauten in-und ausländische Investoren für Einheimische und Urlauber statt unten im Tal oft lieber hoch oben auf dem Berg. Sie entschieden
entwickelte sich Frankreichs hochalpine Landschaft nach dem Zweiten Weltkrieg progressiver: Die Staatsregierung befürwortete und förderte schon zu Zeiten Charles de Gaulles zusammen mit den Touristikern die Idee eines organisierten Frühjahrsurlaubs der ganzen arbeitenden Bevölkerung in den Bergen sowie eines weitgehend problemlosen „Ski in, Ski out“, ohne tägliches Verkehrsaufkommen. Unterstützt vom französischen Staat bauten in-und ausländische Investoren für Einheimische und Urlauber statt unten im Tal oft lieber hoch oben auf dem Berg. Sie entschieden  sich zudem häufig für großformatige Neubaukomplexe. Diese nehmen dann zwar viel Platz ein, andererseits überlassen sie aber den Bewohnern und Besuchern den ganzen riesigen Rest der Landschaft als freie Natur. Mit unverbautem Blick können die Menschen dann von drinnen das wichtigste Ziel der Reise genießen: die Berge.
sich zudem häufig für großformatige Neubaukomplexe. Diese nehmen dann zwar viel Platz ein, andererseits überlassen sie aber den Bewohnern und Besuchern den ganzen riesigen Rest der Landschaft als freie Natur. Mit unverbautem Blick können die Menschen dann von drinnen das wichtigste Ziel der Reise genießen: die Berge. Es wird in La Plagne und seinen Satellitendörfern – wie Plagne Villages oder Plagne Soleil – so wenig wie anderswo eine einhellige Ansicht über die Schönheit der großen Baustrukturen geben, die oftmals die konstruktivistischen und sozialrevolutionären Ideen ihrer Bauzeit vor 50 Jahren zur Schau tragen. Heute lassen sich jedoch besonders in den Savoyer Alpen einige wesentliche Vorzüge dieser vorausschauenden Bauweise erkennen: Erstens, die Menschen verbringen hier seit Jahrzehnten hoch oben ihren Skiurlaub. 135 Lifte erschließen die 225 Pistenkilometer des – zusätzlich noch mit Les Arcs verbundenen – absolut schneesicheren Skigebiets Paradiski, das bis auf 3.400 Meter reicht. Die Gäste wohnen also nicht wie meist in den Ostalpen unten im Tal, wo sie zur Hochfahrt oft erst einmal ihre Verbrennerautos anwerfen und dabei selbst an Weihnachten häufig die künstlich erzeugten weißen Pistenschneebänder zwischen frustrierend viel Grau und Grün erleben müssen. Zweitens, die unterirdischen Parkplätze und Zugangswege ermöglichen komplett autofreie Skistationen wie Belle Plagne, wo auf 2050 Höhenmetern die Gäste zwischen den Herbergen, Appartements, Restaurants und Geschäften bis fast zu ihrem Hotelbett wedeln können, weil ihnen bis dorthin weder Autos noch Straßen den Weg versperren.
Es wird in La Plagne und seinen Satellitendörfern – wie Plagne Villages oder Plagne Soleil – so wenig wie anderswo eine einhellige Ansicht über die Schönheit der großen Baustrukturen geben, die oftmals die konstruktivistischen und sozialrevolutionären Ideen ihrer Bauzeit vor 50 Jahren zur Schau tragen. Heute lassen sich jedoch besonders in den Savoyer Alpen einige wesentliche Vorzüge dieser vorausschauenden Bauweise erkennen: Erstens, die Menschen verbringen hier seit Jahrzehnten hoch oben ihren Skiurlaub. 135 Lifte erschließen die 225 Pistenkilometer des – zusätzlich noch mit Les Arcs verbundenen – absolut schneesicheren Skigebiets Paradiski, das bis auf 3.400 Meter reicht. Die Gäste wohnen also nicht wie meist in den Ostalpen unten im Tal, wo sie zur Hochfahrt oft erst einmal ihre Verbrennerautos anwerfen und dabei selbst an Weihnachten häufig die künstlich erzeugten weißen Pistenschneebänder zwischen frustrierend viel Grau und Grün erleben müssen. Zweitens, die unterirdischen Parkplätze und Zugangswege ermöglichen komplett autofreie Skistationen wie Belle Plagne, wo auf 2050 Höhenmetern die Gäste zwischen den Herbergen, Appartements, Restaurants und Geschäften bis fast zu ihrem Hotelbett wedeln können, weil ihnen bis dorthin weder Autos noch Straßen den Weg versperren. Der nachhaltige Wert einzelner Großgebäude in den Alpen zeigt sich unter anderem darin, dass diese Einheiten nach teilweise mehr als 50 Jahren Betrieb noch immer jedes Jahr viele tausende Wintertouristen aufnehmen. Vornehmlich Familien, aber auch Freundesgruppen. Während in Deutschland die Mittelklasse damit hadert, sich das Skifahren künftig vielleicht gar nicht mehr leisten zu können. Tatsächlich bezeichnet sich La Plagne in seiner aktuellen Werbung als die Skistation mit den meisten Besuchern in der ganzen Welt: 575.000 Gäste besuchen jedes Jahr die insgesamt 11 Skidörfer, aus denen La Plagne besteht. 56.000 Betten stehen dafür zur Verfügung. Selbst in der Tarentaise, die von sportlichen, kulinarischen und architektonischen Superlativen (Tignes, Courchevel, Meribel, Les Arcs, Val d´Isère…) verwöhnt wird, ist das einsame Spitze. Die größte der Baustrukturen von La Plagne – es handelt sich dabei um das architektonisch ikonische Plagne Bellecôte mit diversen Sichtbetontürmen – trägt seit vielen Jahren den Spitznamen Barrage. Auf französisch bedeutet das so viel wie Staumauer. Das ist natürlich Ausdruck einer gewissen Zweideutigkeit. Fest steht indes, dass „die Staumauer“ immer noch jedes Jahr von tausenden ganz normalen Franzosen, Belgiern, Engländern und Skandinaviern bewohnt wird (allerdings nicht mehr so häufig wie früher von Deutschen). Das zweite bekannte große Gebäude des Skigebiets von La Plagne
Der nachhaltige Wert einzelner Großgebäude in den Alpen zeigt sich unter anderem darin, dass diese Einheiten nach teilweise mehr als 50 Jahren Betrieb noch immer jedes Jahr viele tausende Wintertouristen aufnehmen. Vornehmlich Familien, aber auch Freundesgruppen. Während in Deutschland die Mittelklasse damit hadert, sich das Skifahren künftig vielleicht gar nicht mehr leisten zu können. Tatsächlich bezeichnet sich La Plagne in seiner aktuellen Werbung als die Skistation mit den meisten Besuchern in der ganzen Welt: 575.000 Gäste besuchen jedes Jahr die insgesamt 11 Skidörfer, aus denen La Plagne besteht. 56.000 Betten stehen dafür zur Verfügung. Selbst in der Tarentaise, die von sportlichen, kulinarischen und architektonischen Superlativen (Tignes, Courchevel, Meribel, Les Arcs, Val d´Isère…) verwöhnt wird, ist das einsame Spitze. Die größte der Baustrukturen von La Plagne – es handelt sich dabei um das architektonisch ikonische Plagne Bellecôte mit diversen Sichtbetontürmen – trägt seit vielen Jahren den Spitznamen Barrage. Auf französisch bedeutet das so viel wie Staumauer. Das ist natürlich Ausdruck einer gewissen Zweideutigkeit. Fest steht indes, dass „die Staumauer“ immer noch jedes Jahr von tausenden ganz normalen Franzosen, Belgiern, Engländern und Skandinaviern bewohnt wird (allerdings nicht mehr so häufig wie früher von Deutschen). Das zweite bekannte große Gebäude des Skigebiets von La Plagne reckt wie ein Kreuzfahrtschiff seine Decks gen Himmel. Es ist dies eine Residenz auf 2100 Metern, in der Appartements, Hotelbetten, Geschäfte, Skiverleihfirmen und andere Läden zusammen untergebracht sind. Dieses – unzweifelhaft sehr elegante – Gebäude von 1969 genießt längst Denkmalschutz. Wenn es stimmt, dass die Menschen Gebäude schätzen, die an ein Tier, eine Pflanze oder an ein Ding erinnern, dann ist vielleicht der Grund dafür gefunden, warum die Menschen das Paquebot des neiges (etwa „Schneekreuzfahrtschiff“ ) in Plagne Aime 2000 sogar noch lieber mögen als ihre Staumauer. Dazu kommt der Vorteil, dass man auf dem benachbarten Gletscher Dôme de Bellecôte (3417 m) noch länger nicht ernsthaft mit Schneeknappheit rechnen muss.
reckt wie ein Kreuzfahrtschiff seine Decks gen Himmel. Es ist dies eine Residenz auf 2100 Metern, in der Appartements, Hotelbetten, Geschäfte, Skiverleihfirmen und andere Läden zusammen untergebracht sind. Dieses – unzweifelhaft sehr elegante – Gebäude von 1969 genießt längst Denkmalschutz. Wenn es stimmt, dass die Menschen Gebäude schätzen, die an ein Tier, eine Pflanze oder an ein Ding erinnern, dann ist vielleicht der Grund dafür gefunden, warum die Menschen das Paquebot des neiges (etwa „Schneekreuzfahrtschiff“ ) in Plagne Aime 2000 sogar noch lieber mögen als ihre Staumauer. Dazu kommt der Vorteil, dass man auf dem benachbarten Gletscher Dôme de Bellecôte (3417 m) noch länger nicht ernsthaft mit Schneeknappheit rechnen muss. Die Zukunft von La Plagne – und vor allem die der durch Höhenlage verwöhnten Stationen Belle Plagne und Aime 20000 – scheint durch den bis in den Mai zuverlässig auf natürliche Weise fallenden Schnee noch ziemlich lange gesichert zu sein. Als zweite wichtige Säule des künftigen Wintertourismus kommt ein sehr rationaler Umgang mit der Wirklichkeit des Jahres 2024 ins Spiel. Denn angemessenerweise bemüht sich La Plagne schon jetzt um die Wintersportgäste von morgen. Seit 2021 bereitet sich La Plagne intensiv auf das anspruchsvolle, von den Mountain Rivers vergebene Umweltzertifikat Flocon
Die Zukunft von La Plagne – und vor allem die der durch Höhenlage verwöhnten Stationen Belle Plagne und Aime 20000 – scheint durch den bis in den Mai zuverlässig auf natürliche Weise fallenden Schnee noch ziemlich lange gesichert zu sein. Als zweite wichtige Säule des künftigen Wintertourismus kommt ein sehr rationaler Umgang mit der Wirklichkeit des Jahres 2024 ins Spiel. Denn angemessenerweise bemüht sich La Plagne schon jetzt um die Wintersportgäste von morgen. Seit 2021 bereitet sich La Plagne intensiv auf das anspruchsvolle, von den Mountain Rivers vergebene Umweltzertifikat Flocon  vert vor, das für grüne Verdienste im Skibetrieb verliehen wird. Es gibt in Deutschland, Österreich oder der Schweiz nichts Vergleichbares. Man hat den Kampf aufgenommen und ist – anders als viele Nachbarskiorte – mit einem ehrgeizigen Umweltschutzprogramm in den Wettbewerb um das grüne Siegel eingestiegen. Die Verantwortlichen haben für die Saison 2023/24 nun schon zum zweiten Mal eine 50-seitige Broschüre produziert, in der sie ihre Mitarbeiter auf Nachhaltigkeit einschwören, ihre zahlreichen Schritte in Richtung Biodiversität erklären, intensiv Gäste und Gastgeber sensibilisieren sowie ihre Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und zur Verbesserung der Qualität des lokalen Lebens skizzieren. Kreislaufwirtschaft, Reduktion von Strom und Treibstoff, Vermeidung von Mikrokunststoff im Trinkwasser sind nur einige der Ziele, die alle Lebensbereiche betreffen. Das ist umso bemerkenswerter, als viele andere Skiorte in den Alpen noch immer glauben, das nicht tun zu müssen und es an Demut vor der zu schützenden Natur mangelt.
vert vor, das für grüne Verdienste im Skibetrieb verliehen wird. Es gibt in Deutschland, Österreich oder der Schweiz nichts Vergleichbares. Man hat den Kampf aufgenommen und ist – anders als viele Nachbarskiorte – mit einem ehrgeizigen Umweltschutzprogramm in den Wettbewerb um das grüne Siegel eingestiegen. Die Verantwortlichen haben für die Saison 2023/24 nun schon zum zweiten Mal eine 50-seitige Broschüre produziert, in der sie ihre Mitarbeiter auf Nachhaltigkeit einschwören, ihre zahlreichen Schritte in Richtung Biodiversität erklären, intensiv Gäste und Gastgeber sensibilisieren sowie ihre Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und zur Verbesserung der Qualität des lokalen Lebens skizzieren. Kreislaufwirtschaft, Reduktion von Strom und Treibstoff, Vermeidung von Mikrokunststoff im Trinkwasser sind nur einige der Ziele, die alle Lebensbereiche betreffen. Das ist umso bemerkenswerter, als viele andere Skiorte in den Alpen noch immer glauben, das nicht tun zu müssen und es an Demut vor der zu schützenden Natur mangelt.


 Anders als die italienischen Veranstaltungsorte vergangener Olympiaden (und auch als einige französische wie Courchevel) haben die Verantwortlichen in La Plagne ihre alte olympische Stätte nicht verkommen lassen. Sie nutzen sie vielmehr weiter für Wettbewerbe. Und sie geben sie – mit extra entwickelten und gesicherten Spezialschlitten – zum Gaudium der Allgemeinheit die ganze restliche Saison für jenen Teil der Bevölkerung frei, der schon lange mal Lust hatte, es den Tollkühnen in ihren beinahe fliegenden Schalen gleichzutun. Dort darf jedefrau und jedermann – eben alle, die sich trauen – eine Fahrt über die originale olympische Rennstrecke mit einem erfahrenen Bobpiloten oder einem automatisch gesteuerten Gefährt bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h wagen. Olympia ist hier im Alltag der Bewohner von La Plagne angekommen. Sie sind stolz auf diese Vergangenheit. Auch deshalb hat sich Frankreich – mit Nizza für das Olympische Dorf und mit La Plagne (samt der alten als der neuen Bobbahn) – gerade wieder für die Winterolympiade 2030 beworben. Der Erfolg wäre ganz allgemein ein Segen für die Nachhaltigkeit der Olympischen Spiele.
Anders als die italienischen Veranstaltungsorte vergangener Olympiaden (und auch als einige französische wie Courchevel) haben die Verantwortlichen in La Plagne ihre alte olympische Stätte nicht verkommen lassen. Sie nutzen sie vielmehr weiter für Wettbewerbe. Und sie geben sie – mit extra entwickelten und gesicherten Spezialschlitten – zum Gaudium der Allgemeinheit die ganze restliche Saison für jenen Teil der Bevölkerung frei, der schon lange mal Lust hatte, es den Tollkühnen in ihren beinahe fliegenden Schalen gleichzutun. Dort darf jedefrau und jedermann – eben alle, die sich trauen – eine Fahrt über die originale olympische Rennstrecke mit einem erfahrenen Bobpiloten oder einem automatisch gesteuerten Gefährt bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h wagen. Olympia ist hier im Alltag der Bewohner von La Plagne angekommen. Sie sind stolz auf diese Vergangenheit. Auch deshalb hat sich Frankreich – mit Nizza für das Olympische Dorf und mit La Plagne (samt der alten als der neuen Bobbahn) – gerade wieder für die Winterolympiade 2030 beworben. Der Erfolg wäre ganz allgemein ein Segen für die Nachhaltigkeit der Olympischen Spiele. Der Skipass für La Plagne im Gebiet Paradiski kostet in der Saison 2023/24 pro Tag für Erwachsene 65 €, für Kinder 52 €. Die Skisaison dauert dort noch bis zum 28. April. Das kürzlich renovierte Hotel Eden des Cimes **** in Belle Plagne bietet im April 2024 zwei Nächte mit Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer für 580 €. Appartements in der Residenz Paquebot des Neiges in Plagne Aime 2100 waren Anfang April auf verschiedenen Plattformen ab 98 € pro Tag zu buchen.
Der Skipass für La Plagne im Gebiet Paradiski kostet in der Saison 2023/24 pro Tag für Erwachsene 65 €, für Kinder 52 €. Die Skisaison dauert dort noch bis zum 28. April. Das kürzlich renovierte Hotel Eden des Cimes **** in Belle Plagne bietet im April 2024 zwei Nächte mit Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer für 580 €. Appartements in der Residenz Paquebot des Neiges in Plagne Aime 2100 waren Anfang April auf verschiedenen Plattformen ab 98 € pro Tag zu buchen. Luxus im Skisport, das hieß mal: Teure Sportkleidung, schicke Hotels mit gigantischen Wellnesslandschaften – und vielleicht noch ein superber Helikopterflug in unberührte Tiefschneereviere. Vorbei.
Luxus im Skisport, das hieß mal: Teure Sportkleidung, schicke Hotels mit gigantischen Wellnesslandschaften – und vielleicht noch ein superber Helikopterflug in unberührte Tiefschneereviere. Vorbei. aus Europas Großstädten dazu animieren, ungeheure Summen für ein Skiurlaubsvergnügen auszugeben, das mehr und mehr umweltschädlichen Kunstschnee benötigt, das immer noch teurer wird und gleichzeitig immer weniger als Anlass für begeisterte Gespräche unter Freuden taugt?
aus Europas Großstädten dazu animieren, ungeheure Summen für ein Skiurlaubsvergnügen auszugeben, das mehr und mehr umweltschädlichen Kunstschnee benötigt, das immer noch teurer wird und gleichzeitig immer weniger als Anlass für begeisterte Gespräche unter Freuden taugt? Neuen Luxus herkömmlicher Machart gibt es auch noch, nebenan in der Kurlandschaft von Bad Gastein. In einem Ort, wo täglich reichlich heißes Wasser als erneuerbare Energie direkt aus dem Felsen kommt, macht das immerhin auch künftig Sinn. Deshalb hat zu Beginn des Jahres 2024 das „Badeschloss“ aufgemacht – ein 13 Stockwerke hoher Hotelturm, der seit kurzem als „künstlicher Felsen“ aus vorgefertigten Betonteilen dem Häusermeer entragt. Er vermittelt zwischen der alten Zuckerbächerpracht der Barockfassaden und dem hier im Salzburger Land durchaus auch vorhandenen Architekturkonstruktivismus der 1970er Jahre. Gelungen und mutig. Aber nix für Spießeridyllen.
Neuen Luxus herkömmlicher Machart gibt es auch noch, nebenan in der Kurlandschaft von Bad Gastein. In einem Ort, wo täglich reichlich heißes Wasser als erneuerbare Energie direkt aus dem Felsen kommt, macht das immerhin auch künftig Sinn. Deshalb hat zu Beginn des Jahres 2024 das „Badeschloss“ aufgemacht – ein 13 Stockwerke hoher Hotelturm, der seit kurzem als „künstlicher Felsen“ aus vorgefertigten Betonteilen dem Häusermeer entragt. Er vermittelt zwischen der alten Zuckerbächerpracht der Barockfassaden und dem hier im Salzburger Land durchaus auch vorhandenen Architekturkonstruktivismus der 1970er Jahre. Gelungen und mutig. Aber nix für Spießeridyllen. Den vollen Charme kann das neue Hotel Badeschloss jedoch erst entfalten, wenn auch der sogenannte vertical link Wirklichkeit ist. So heißt ein für 2025 geplantes, aber wohl erst später zu realisierendes Projekt für ein kilometerlanges unterirdisches Förderband, eventuell mit Rolltreppen, das den Ortskern beim berühmten Wasserfall mit dem sehr viel höher gelegenen Bahnhof und der Stubnerkogelseilbahn verbinden wird. Eine grüne und soziale Idee, für die aber noch viel Bautätigkeit nötig ist. Danach
Den vollen Charme kann das neue Hotel Badeschloss jedoch erst entfalten, wenn auch der sogenannte vertical link Wirklichkeit ist. So heißt ein für 2025 geplantes, aber wohl erst später zu realisierendes Projekt für ein kilometerlanges unterirdisches Förderband, eventuell mit Rolltreppen, das den Ortskern beim berühmten Wasserfall mit dem sehr viel höher gelegenen Bahnhof und der Stubnerkogelseilbahn verbinden wird. Eine grüne und soziale Idee, für die aber noch viel Bautätigkeit nötig ist. Danach kann jede:r die hier extrem steilen Strecken von den Hotels zu den Zügen und Liften samt Kindern und Skiausrüstung bequem als Fußgänger bewältigen. Statt, wie bisher, per Auto.
kann jede:r die hier extrem steilen Strecken von den Hotels zu den Zügen und Liften samt Kindern und Skiausrüstung bequem als Fußgänger bewältigen. Statt, wie bisher, per Auto.
 Kennen Sie die Zeno 3? Das ist eine nach dem italienischen Abfahrts-Olympiasieger von Oslo 1952 benannte, über weite Strecken blaue
Kennen Sie die Zeno 3? Das ist eine nach dem italienischen Abfahrts-Olympiasieger von Oslo 1952 benannte, über weite Strecken blaue  Ein schottisch-schwedisch-deutsches Skifahrer-Dream-Team war hier, jeder auf eigene Faust, unterwegs. Die drei Autoren Christoph Schrahe, Jimmy Petterson und Patrick Thorne arbeiten seit vielen Jahren – und jeweils mit leicht differierenden Rekordambitionen – daran, hunderte Skiparadiese auf allen Kontinenten unter ihre Bretter zu kriegen.
Ein schottisch-schwedisch-deutsches Skifahrer-Dream-Team war hier, jeder auf eigene Faust, unterwegs. Die drei Autoren Christoph Schrahe, Jimmy Petterson und Patrick Thorne arbeiten seit vielen Jahren – und jeweils mit leicht differierenden Rekordambitionen – daran, hunderte Skiparadiese auf allen Kontinenten unter ihre Bretter zu kriegen.
 aus man aufs Mittelmeer blicken kann). Die „Faust“ über dem Retorten-Skiort Flaine ist eine breite Genusspiste im Grand Massif (nahe des Genfer Sees), die zu zwei Dritteln über der Waldgrenze liegt. Sie gewährt einen genialen Blick hinunter auf Marcel Breuers „Bauhaus-Dorf“, das die vielleicht überraschendste Skistation der Welt darstellt. Die Topographie zeigt typische Felsbänder aus Kalk und Sandstein, die hier überall spröde den Schnee durchbrechen. Bei schönem Wetter überragt der Mont Blanc die Szenerie.
aus man aufs Mittelmeer blicken kann). Die „Faust“ über dem Retorten-Skiort Flaine ist eine breite Genusspiste im Grand Massif (nahe des Genfer Sees), die zu zwei Dritteln über der Waldgrenze liegt. Sie gewährt einen genialen Blick hinunter auf Marcel Breuers „Bauhaus-Dorf“, das die vielleicht überraschendste Skistation der Welt darstellt. Die Topographie zeigt typische Felsbänder aus Kalk und Sandstein, die hier überall spröde den Schnee durchbrechen. Bei schönem Wetter überragt der Mont Blanc die Szenerie.
 auch eine Speed-Skiing-Strecke existierte, auf der Weltrekorde jenseits der 250 Stundenkilometer erzielt wurden. Seit ein paar Jahren wird genau dieses Areal von einer Zipline / Seilrutsche erschlossen, die Passagieren einen 70-sekündigen „Flug“ über das Areal bei Tempo 130 ermöglicht.
auch eine Speed-Skiing-Strecke existierte, auf der Weltrekorde jenseits der 250 Stundenkilometer erzielt wurden. Seit ein paar Jahren wird genau dieses Areal von einer Zipline / Seilrutsche erschlossen, die Passagieren einen 70-sekündigen „Flug“ über das Areal bei Tempo 130 ermöglicht.

 Für mich besteht der größte Luxus einer Schlossbesichtigung in der Vorstellung, sich für einen Moment an diesem Ort ganz zu Hause zu fühlen. Und der Frage, wie ich mir in den fürstlichen Gemächern und royalen Gartenanlagen die Zeit wohl am herrlichsten vertreiben könnte. Grandioses Kopfkino. Allerdings schränkt die Menge der Mitwirkenden diese Art von Genuss empfindlich ein: Bei 1, 4 Millionen jährlichen Neuschwanstein-Gästen etwa kann keine Stimmung aufkommen.
Für mich besteht der größte Luxus einer Schlossbesichtigung in der Vorstellung, sich für einen Moment an diesem Ort ganz zu Hause zu fühlen. Und der Frage, wie ich mir in den fürstlichen Gemächern und royalen Gartenanlagen die Zeit wohl am herrlichsten vertreiben könnte. Grandioses Kopfkino. Allerdings schränkt die Menge der Mitwirkenden diese Art von Genuss empfindlich ein: Bei 1, 4 Millionen jährlichen Neuschwanstein-Gästen etwa kann keine Stimmung aufkommen.
 Alle Parkbauten – außer dem sogenannten Königshäuschen – liegen im Dornröschenschlaf, die Wasserspiele sind eingestellt. Steinerne Figuren und Zinkgussvasen werden mit maßgefertigten Einhausungen geschützt. Manche erinnern an die Freiluftskulpturen und amorphen Passstücke von Franz West, die mit ihren ungeschönten Nahtstellen und ruppigen Oberflächen als unförmige Auswüchse „Neurosen sichtbar machen“, wie der Künstler einmal sagte.
Alle Parkbauten – außer dem sogenannten Königshäuschen – liegen im Dornröschenschlaf, die Wasserspiele sind eingestellt. Steinerne Figuren und Zinkgussvasen werden mit maßgefertigten Einhausungen geschützt. Manche erinnern an die Freiluftskulpturen und amorphen Passstücke von Franz West, die mit ihren ungeschönten Nahtstellen und ruppigen Oberflächen als unförmige Auswüchse „Neurosen sichtbar machen“, wie der Künstler einmal sagte. Hoch über der Terrassenanlage ragt ein griechischer Rundtempel auf, im Zentrum eine marmorne Venusfigur mit zwei Amoretten. Den Monopteros umgibt ein Reifrock aus Plastikplanen, als hätten Christo und Jeanne-Claude diese Abdeckung ersonnen. Und auf der Nordseite des Schlosses lässt eine verhüllte Neptungruppe, die den unteren Abschluss der Kaskade bildet, an die Wrapped Objects des Künstlerpaares denken.
Hoch über der Terrassenanlage ragt ein griechischer Rundtempel auf, im Zentrum eine marmorne Venusfigur mit zwei Amoretten. Den Monopteros umgibt ein Reifrock aus Plastikplanen, als hätten Christo und Jeanne-Claude diese Abdeckung ersonnen. Und auf der Nordseite des Schlosses lässt eine verhüllte Neptungruppe, die den unteren Abschluss der Kaskade bildet, an die Wrapped Objects des Künstlerpaares denken.
 Auch Hundinghütte und Einsiedelei des Gurnemanz liegen hermetisch verschlossen am östlichen Parkrand. In diesen stillen Winkel verirrt sich heute kaum jemand. Ludwig II. nutzte die von den Bühnenbildern aus den Wagner-Opern Parsifal beziehungsweise Walküre inspirierten Klausen als Rückzugsorte zur Lektüre oder um zwischen Bärenhäuten an seiner Privatmythologie weiterzuspinnen. Derart abgeriegelt wird die Architektur zur Skulptur und die Fiktion wandelt sich zur Realität. Vor allem die Einsiedelei wirkt mit ihrem windschiefen, von Baumstämmen gestützten Schindeldach wie ein Vorgängermodell zu Mark Dions Witches‘ Cottage, erst 2022 im Morsbroicher Skulpturenpark entstanden. Die Kunst, in allem Kunst zu sehen, hier lässt sie sich vorzüglich trainieren.
Auch Hundinghütte und Einsiedelei des Gurnemanz liegen hermetisch verschlossen am östlichen Parkrand. In diesen stillen Winkel verirrt sich heute kaum jemand. Ludwig II. nutzte die von den Bühnenbildern aus den Wagner-Opern Parsifal beziehungsweise Walküre inspirierten Klausen als Rückzugsorte zur Lektüre oder um zwischen Bärenhäuten an seiner Privatmythologie weiterzuspinnen. Derart abgeriegelt wird die Architektur zur Skulptur und die Fiktion wandelt sich zur Realität. Vor allem die Einsiedelei wirkt mit ihrem windschiefen, von Baumstämmen gestützten Schindeldach wie ein Vorgängermodell zu Mark Dions Witches‘ Cottage, erst 2022 im Morsbroicher Skulpturenpark entstanden. Die Kunst, in allem Kunst zu sehen, hier lässt sie sich vorzüglich trainieren.
 Im Königshäuschen, der Urzelle des heutigen Schlosses, rollt die aktuelle Ausstellung „Vom Lydner-Hof zum Schloss“ die gesamte Geschichte auf: angefangen beim Namensstifter Hans Linder, der hier ab 1479 einen Hof bewirtschaftete, über Königin Marie von Bayern – Ludwigs Mutter –, die in einer feschen Tracht aus schwarzem Loden auf die Berge stieg und als eine der ersten bayerischen Alpinistinnen gelten darf, bis hin zu den touristischen Anfängen im August 1886. Übrigens nur wenige Wochen, nachdem der Kini am 13. Juni im Starnberger See tot aufgefunden worden war.
Im Königshäuschen, der Urzelle des heutigen Schlosses, rollt die aktuelle Ausstellung „Vom Lydner-Hof zum Schloss“ die gesamte Geschichte auf: angefangen beim Namensstifter Hans Linder, der hier ab 1479 einen Hof bewirtschaftete, über Königin Marie von Bayern – Ludwigs Mutter –, die in einer feschen Tracht aus schwarzem Loden auf die Berge stieg und als eine der ersten bayerischen Alpinistinnen gelten darf, bis hin zu den touristischen Anfängen im August 1886. Übrigens nur wenige Wochen, nachdem der Kini am 13. Juni im Starnberger See tot aufgefunden worden war.